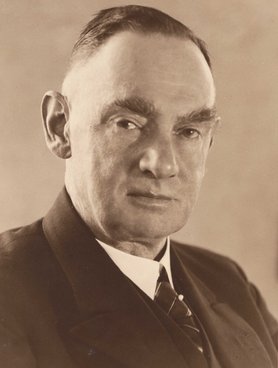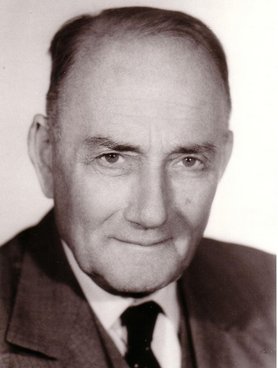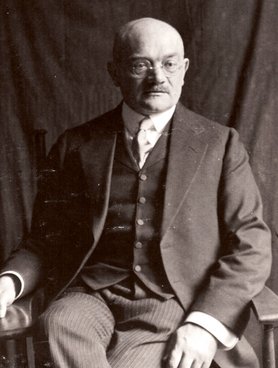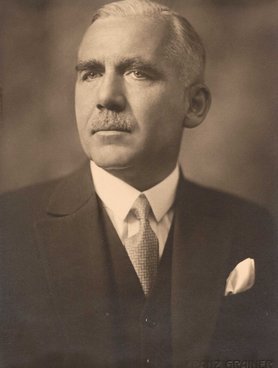1933– 1945
Der Reichsfinanzhof im Nationalsozialismus
Die Steuerrechtsprechung im Dienst des Nationalsozialimus

Copyright: Bayerische Staatsbibliothek
Die Stellung des Reichsfinanzhofs als unabhängige dritte Gewalt wurde in der Zeit des Nationalsozialismus stetig und zunehmend ausgehöhlt. Der Reichsfinanzhof wurde als weisungsgebundene Abteilung des Reichsfinanzministeriums angesehen. Das Steuerrecht wurde in den Dienst der nationalsozialistischen Weltanschauung gestellt. Der RFH diskriminierte in seiner Rechtsprechung Judentum, Kirche, geistliche Orden und Religionsgesellschaften, deren Grundausrichtung der nationalsozialistischen Ideologie widersprach.
Steueranpassungsgesetz 1934
In den Jahren ab 1933 bestand die erforderliche Bindung an Gesetz wie auch Recht nur noch eingeschränkt. Der Nationalsozialismus hat die Gesetzgebung stark beeinflusst. Nach dem Steueranpassungsgesetz war der Beurteilung gesetzlicher Tatbestände die nationalsozialistische Weltanschauung zugrunde zu legen.
§ 1 des Steueranpassungsgesetzes 1934 lautete: „Die Steuergesetze sind nach nationalsozialistischer Weltanschauung auszulegen.“ Auf dieser Grundlage sollte der Reichsfinanzhof bei den vor 1933 in Kraft getretenen Vorschriften prüfen, ob sie der nationalsozialistischen Weltanschauung entsprachen und wenn nicht entsprechend der nationalsozialistischen Weltanschauung uminterpretieren. So wirkte der Nationalsozialismus massiv auf den RFH und dessen Rechtsprechung ein.
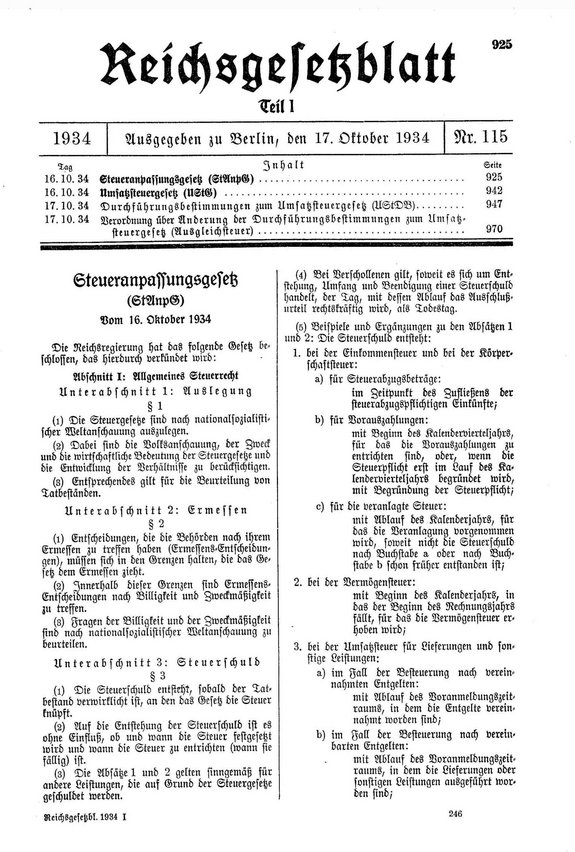
Copyright: Österreichische Nationalbibliothek
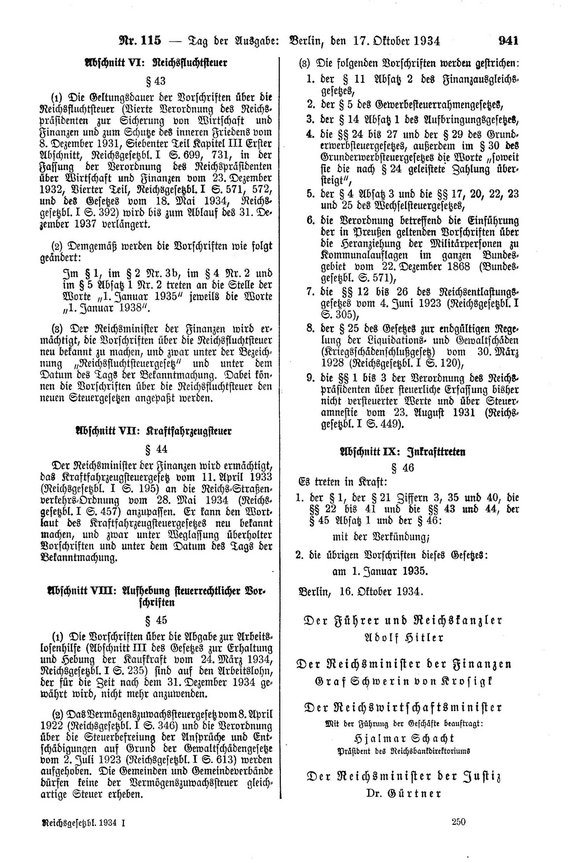
Copyright: Österreichische Nationalbibliothek
RFH als Gehilfe des Reichsfinanzministerium
Im Wesentlichen verantwortlich dafür war der Staatssekretär im Reichfinanzministerium Fritz Reinhardt. Dieser beschrieb die Rolle des RFH im Jahre 1935 öffentlich mit den Worten, der Reichsfinanzhof sei im nationalsozialistischen Staat der Gehilfe des Reichsministers der Finanzen bei der Auslegung der Steuergesetze und bei der Entwicklung des Steuerrechts nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Weltanschauung. Der Reichsfinanzhof – als von Gesetzes wegen eigentlich unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege – ordnete sich zunehmend dem Willen des Reichsfinanzministeriums unter.

Copyright: Österreichische Nationalbibliothek

Copyright: Bundesfinanzakademie/Foto Julia Heß
Entlassungen von RFH-Richtern
Bereits vor 1935 führte die Machtergreifung der Nationalsozialisten beim Reichsfinanzhof sehr rasch zu schwerwiegenden personellen Konsequenzen. Aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 verloren zunächst mehrere Mitglieder des Reichsfinanzhof, die entweder „nicht arischer Abstammung“ oder aus Sicht der neuen Machthaber „politisch unzuverlässig“ waren, ihre Ämter.
Dies betraf den seit 1931 amtierenden Chefpräsidenten des Gerichts Prof. Dr. Herbert Dorn, der sich zuvor in seiner Eigenschaft als hoher Ministerialbeamter große Verdienste um das Deutsche Reich erworben hatte. Der international hoch angesehene zweite Präsident des Reichsfinanzhofs wurde aufgrund seiner jüdischen Abstammung aus dem Amt gedrängt und emigrierte über die Schweiz und Kuba in die USA.
Weitere Richter mussten das Gericht aus dem gleichen Grund verlassen. Auch der Senatspräsident Heinrich Zapf, der der Zentrumspartei nahestand, wurde entlassen.
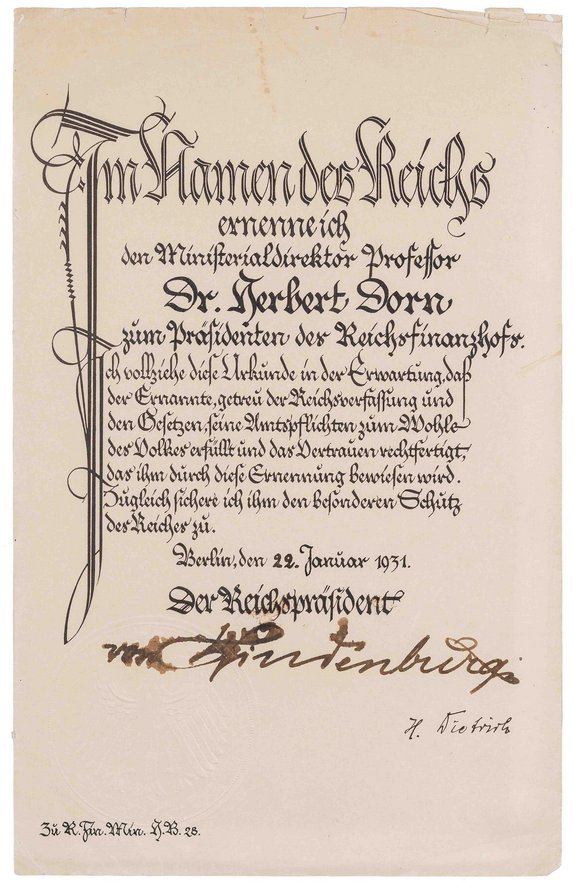
Copyright: Bundesfinanzhof
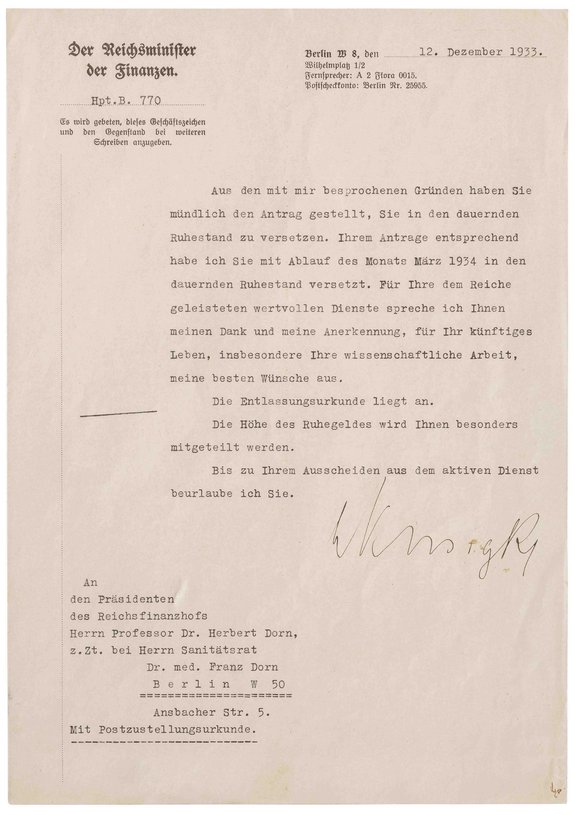
Copyright: Bundesfinanzhof
Deportationen von RFH-Richtern
Als Folge der Nürnberger Rassegesetze wurden zum Jahresende 1935 auch die Reichsfinanzräte Dr. Franz Oppens, Dr. Rolf Grabower und Robert Wendriner, die beiden Letzteren hochdekorierte Offiziere des Ersten Weltkrieges, in den vorzeitigen Ruhestand gedrängt. Grabower und Oppens wurden später in Konzentrationslager deportiert, Oppens kam dort um.
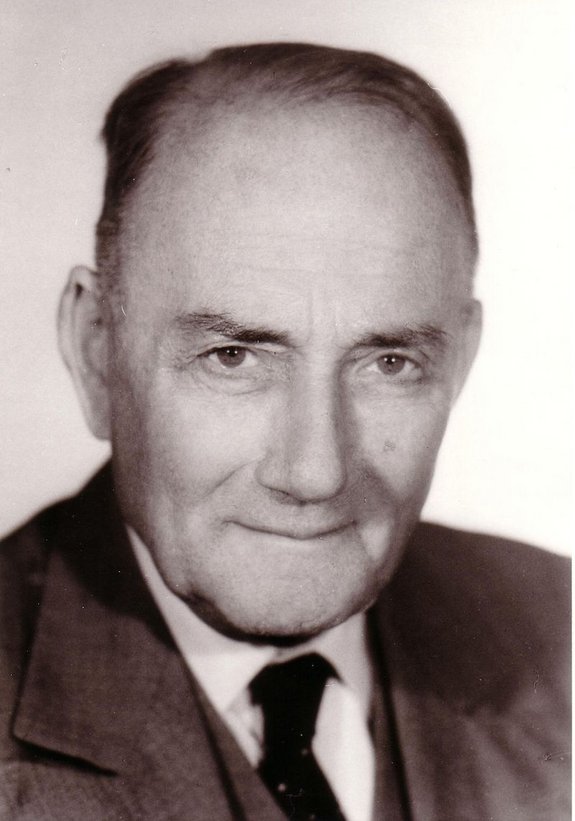
Copyright: Bundesfinanzhof

Copyright: Rolf Grabower
NSDAP-Mitglieder als RFH-Richter
Der Anteil der NSDAP-Mitglieder in der Richterschaft nahm kontinuierlich zu. Es wurden zudem verstärkt Angehörige der Reichsfinanzverwaltung zum Reichsfinanzhof berufen, während in der Weimarer Zeit sehr viele Angehörige des Reichsfinanzhofs in der Zivil- und Verwaltungsjustiz ihre Berufslaufbahn begonnen hatten.
Nahezu zeitgleich wurden allerdings andere Personen, die in leitender Stellung in der Finanzverwaltung tätig waren, den neuen Machthabern politisch aber unzuverlässig erschienen, an den Reichsfinanzhof „abgeschoben“, so die späteren ersten beiden Präsidenten des Bundesfinanzhofs Dr. Heinrich Schmittmann und Dr. Hans Müller. Auch den Würzburger Landesfinanzpräsidenten Alexander Prugger wurde 1933 auf politischen Druck hin als Reichsfinanzrichter an den Reichsfinanzhof versetzt. Er wurde zusätzlich mit einer Beförderungssperre belegt.
Nach dem unerwarteten Versterben des dritten Gerichtspräsidenten Dr. Richard Kloss, der dieses Amt nicht einmal ein Jahr ausüben konnte, wurde mit Dr. Ludwig Mirre am 01.04.1935 der vierte Gerichtspräsident ernannt und stand dem Gericht bis Kriegsende vor. Die amerikanische Militärverwaltung entfernte ihn aus dem Amt und internierte ihn für einige Monate.
Der RFH wird eine Art Abteilung des Reichsfinanzministeriums
1937 wurde zu den bestehenden sechs Senaten der Senat VIa eingerichtet, der speziell für Gemeinnützigkeitssachen zuständig war. Betraf ein Streit etwa die Gemeinnützigkeit kirchlicher und jüdischer Einrichtungen, wurde die Gemeinnnützigkeit aufgrund der §§ 17–19 des Steueranpassungsgesetzes aberkannt. Hier machte sich die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs den nationalsozialistischen Kampf gegen Kirche, Judentum, geistliche Orden und Religionsgesellschaften zu eigen.
Der Führererlass von 1939 machte die Anrufung des RFH ausnahmslos von der Entscheidung des Oberfinanzpräsidenten abhängig. Neben verschiedenen anderen Maßnahmen führte dies dazu, dass der Reichsfinanzhof als unabhängiges Rechtsschutzorgan faktisch ausgeschaltet und zu einer Art Abteilung des Finanzministeriums wurde. Im Justizalltag trat der Reichsfinanzhof als Organ des nationalsozialistischen Staats in Erscheinung. So wurden die mündlichen Verhandlungen mit dem sogenannten deutschen Gruß durch Erheben des rechten Arms und den Worten „Heil Hitler“ begonnen und beendet.
In der Endphase des sogenannten Dritten Reichs kam die Rechtsprechungstätigkeit des Reichsfinanzhofs nahezu vollständig zum Erliegen. Das Dienstgebäude in der Ismaninger Straße 109 hatte im April und Juni 1944 schwere Bombenschäden erlitten. Die Kriegslage führte zur Auslagerung einzelner Senate in kleinere Orte im ländlichen Raum. Die Zahl neu eingehender Verfahren war zudem stark zurückgegangen, weil die Oberfinanzpräsidenten die Rechtsbeschwerde zum Reichsfinanzhof nur ausnahmsweise zuließen. Schließlich markierte die Kapitulation des sogenannten Deutschen Reichs im Mai 1945 das Ende der rund 27-jährigen Geschichte des Reichsfinanzhofs.
Steuerrechtsprechung 1933–1945
Die Bewertung der Rechtsprechung des RFH während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wird dadurch erschwert, dass von den in dieser Zeit rund 30.000 erledigten Verfahren lediglich circa 2.000 Urteile veröffentlicht wurden. Bisher war nur diese geringe Zahl von Entscheidungen Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Richter des RFH vornehmlich solche Urteile veröffentlicht haben, die ihnen besonders wichtig erschienen. Dennoch bleibt die Betrachtung des damaligen richterlichen Tuns unvollständig.
Rein zahlenmäßig überwiegen diejenigen Urteile, die in politisch nicht brisanten Verfahren mit vertretbaren Begründungen zu nachvollziehbaren Ergebnissen gelangten, die problematischen oder eindeutig ungerechten Urteile. Doch waren die Unrechtsurteile zum einen keine seltene Ausnahmeerscheinung. Zum anderen kann begangenes Unrecht nicht mit rein quantitativen Überlegungen gerechtfertigt werden.
Der RFH hat Steuergesetze, die selbst Unrecht enthielten, angewendet und durch seine Auslegung das Unrecht häufig noch verschärft. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der RFH hierbei einem äußeren Zwang ausgesetzt war. Die beachtliche Zahl von NSDAP-Mitgliedern in der Richterschaft lässt den Schluss zu, dass auch nationalsozialistische Überzeugungstäter am Werk waren.
Die Vielzahl hochproblematischer oder eindeutig ungerechter Entscheidungen gegenüber jüdischen Steuerpflichtigen belegt eindeutig, dass der RFH jüdischen Bürgern nicht lediglich den Rechtsschutz im Einzelfall verweigerte. Vielmehr beteiligte er sich mit seiner Rechtsprechung zum Reichsfluchtsteuergesetz und zum Gemeinnützigkeitsrecht aktiv an der finanziellen Ausplünderung der Juden, die elementarer Bestandteil der umfassenden Verfolgungsmaßnahmen des NS-Staates war.
Beispiele der Steuerrechtsprechung im NS-Staat
Die in der Endphase der Weimarer Republik eingeführte Reichsfluchtsteuer fiel bei der Auswanderung deutscher Staatsbürger an. Die Steuer betrug ursprünglich 25 % des Vermögens. Mit dieser enormen steuerlichen Belastung sollte erreicht werden, dass die Bürger in Deutschland bleiben.
Der RFH hat die Reichsfluchtsteuer auf jüdische Bürger angewendet, obgleich diese wegen der nationalsozialistischen Verfolgungen vielfach gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. In seiner Rechtsprechung beschönigte er die Verfolgungsmaßnahmen als bloße Belästigungen und ging entgegen den tatsächlichen Verhältnissen davon aus, dass die Auswanderung von Juden nicht im Interesse des NS-Staates liege.
Die vom RFH vorgenommene Auslegung einzelner Vorschriften des Reichsfluchtsteuergesetzes führte zu zusätzlichen Belastungen und machte die gesetzlich vorgesehenen Steuerbefreiungen unanwendbar. Das Ergebnis war, dass „der Jude eben unter allen Umständen zahlen muss“ (Zitat Gustav Jahn, 1938). Die Reichsfluchtsteuer betraf nicht nur jüdische Bürger. Sämtliche Emigranten, darunter berühmte Schriftsteller und Wissenschaftler, die Deutschland wegen der politischen Verhältnisse verließen oder verlassen mussten, wurden durch diese Steuer eines beträchtlichen Teils ihres Vermögens beraubt.
Die steuerlichen Gemeinnützigkeitsvorschriften ordnen an: Personen werden nicht zu Steuern herangezogen, wenn sie ohne eigenes Gewinnstreben allein Tätigkeiten ausüben, die dem Gemeinwohl dienen. Im sogenannten Dritten Reich wurden die Gemeinnützigkeitsvorschriften neu geregelt. Die Steuerbefreiung wurde allein dann gewährt, wenn die Tätigkeit „dem Wohl der Deutschen Volksgemeinschaft“ nutzte.
In seiner Rechtsprechung bestätigte der RFH nicht nur die Auffassung der Finanzverwaltung, dass die Tätigkeiten jüdischer Organisationen nicht im Sinne dieser Definition gemeinnützig sind. Er lieferte auch die rechtliche Grundlage, um den Gemeinnützigkeitsstatus für viele Jahre rückwirkend zu versagen. Das führte zu extrem hohen Steuernachzahlungen und damit zur Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der bisher als gemeinnützig anerkannten Institutionen. Die Gemeinnützigkeitsrechtsprechung des RFH schadete nicht nur jüdischen Organisationen, sondern auch christlichen Einrichtungen und Ordensgemeinschaften, deren Grundausrichtung der nationalsozialistischen Ideologie widersprach.
Auch außerhalb des Anwendungsbereichs des Reichsfluchtsteuergesetzes und der Gemeinnützigkeitsvorschriften diskriminierte der RFH in seiner Rechtsprechung offen jüdische Kläger aufgrund ihrer Rasse und ihres Glaubens.
Trotz eindeutiger Rechtslage versagte er etwa eine Steuervergünstigung mit der Begründung, „es würde der gesunden deutschen Volksanschauung widersprechen, wenn einem Juden der ermäßigte Steuersatz … zugebilligt würde.“
Der RFH legte bei sogenannten Mischehen zwischen „Ariern“ und Juden jeweils willkürlich entweder den jüdischen Ehemann oder die jüdische Ehefrau zugrunde, um eine Eingruppierung in die ungünstigste Steuerklasse vornehmen zu können.
Der Fall Milch
Das beim RFH unter dem Aktenzeichen IV 47/41 geführte Rechtsbeschwerdeverfahren des Dr. Friedrich Milch zeigt exemplarisch, dass der RFH in seiner Rechtsprechung jüdische Kläger offen aufgrund ihres Glaubens diskriminierte. Das Verfahren beweist auch, wie stark das Reichsfinanzministerium auf den RFH einwirkte, um das politisch erwünschte Urteil zu erreichen. Der Rechtsstreit drehte sich um die einfache Frage, ob die vom Steuerpflichtigen Dr. Milch bezogenen Zinsen mit dem Regelsteuersatz oder gemäß § 34 des damals geltenden Einkommensteuergesetzes lediglich mit einem ermäßigten Steuersatz zu versteuern waren. Das Finanzamt Breslau-Süd hatte die Anwendung des § 34 EStG abgelehnt. Dr. Friedrich Milch ging dagegen vor und legte Rechtsbeschwerde beim RFH ein.
Die Behandlung der Rechtsbeschwerde durch den RFH zeigt in allen wesentlichen Verfahrensabschnitten, dass rechtsstaatliche Maßstäben nicht erfüllt wurden oder ihnen krass widersprochen wurde. Im Folgenden werden sieben Maßnahmen dargestellt und erläutert.
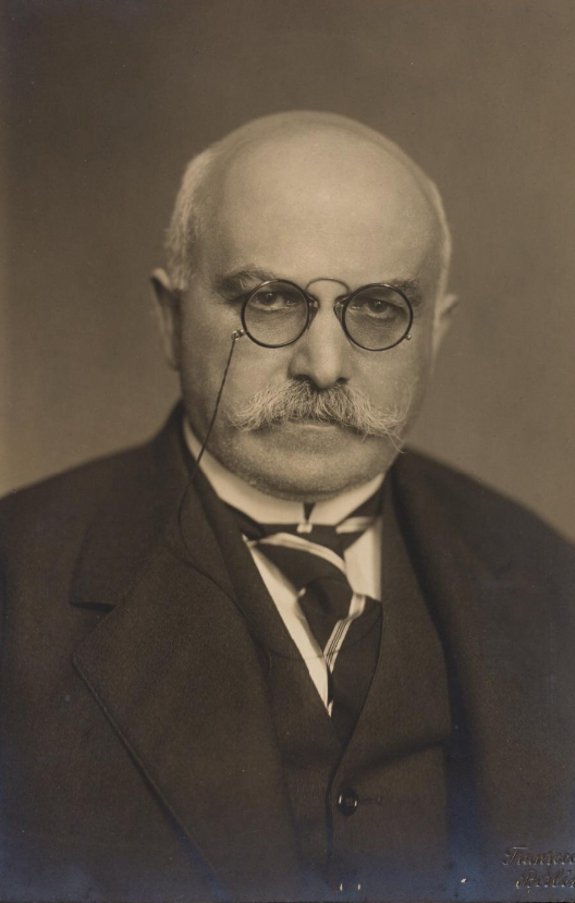
Copyright: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/104249/edition/97317?language=pl
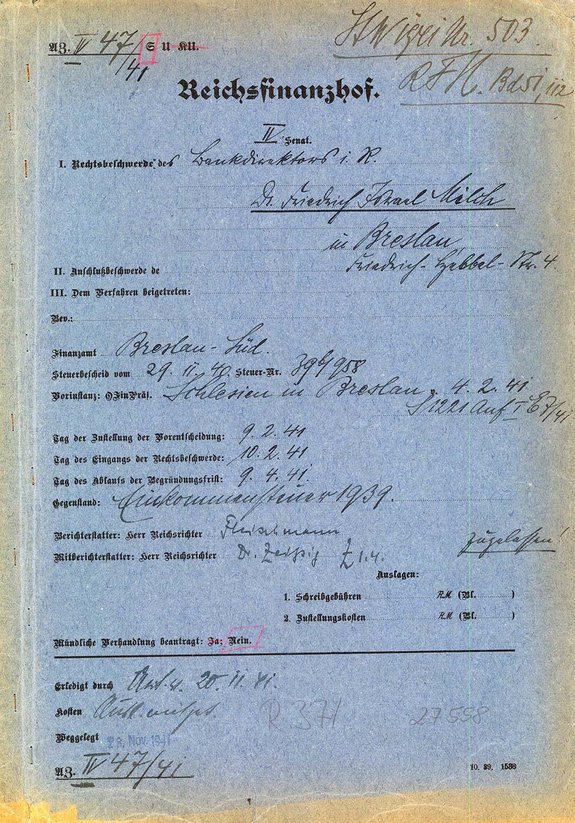
Copyright: Bundesarchiv
Eingang der Rechtsbeschwerde des Dr. Friedrich Milch
Justizrat Dr. Friedrich Milch, ein Bankdirektor im Ruhestand, legte mit dem folgenden Schreiben Rechtsbeschwerde gegen die Anfechtungsentscheidung des Oberfinanzpräsidenten Schlesien ein. Dieser hatte die Entscheidung des Finanzamts bestätigt, dass nach den geltenden Veranlagungsrichtlinien der ermäßigte Steuersatz bei Juden nicht anzuwenden ist.
**Erläuterung:** Das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde entspricht der heutigen Revision. Damals wie heute muss der Kläger mit Namen und ladungsfähiger Anschrift genannt werden. Die Bezeichnung des Klägers Dr. Milch in der Anfechtungsentscheidung und seine Unterschrift auf der Rechtsbeschwerde zeigen, dass jüdische Steuerpflichtige diskriminiert wurden. Im sogenannten Dritten Reich mussten Juden, die bislang keine „typisch jüdischen“ Vornamen getragen hatten, seit 1938 „Israel“ oder „Sara“ als zusätzlichen Vornamen führen. Deshalb wird der Kläger in der gesamten Akte stets als Dr. Friedrich Israel Milch geführt.

Copyright: Bundesarchiv
Die Entscheidungsvorschläge des Reichsrichters Robert Fleischmann
Die folgende Abbildung zeigt die erste Seite des Berichts, den der mit der Bearbeitung des Falles vom IV. Senat des RFH als Berichterstatter eingesetzte Reichsrichter Robert Fleischmann erstellt hat. Robert Fleischmann nennt zwei Möglichkeiten, wie der Fall entschieden werden kann. Nach der ersten Möglichkeit ist die Rechtsbeschwerde erfolglos, weil die Veranlagungsrichtlinien des Reichsfinanzministers es verbieten, Juden steuerliche Vergünstigungen zu gewähren. Nach der zweiten Möglichkeit ist die Rechtsbeschwerde erfolgreich, weil das Einkommensteuergesetz die Steuerermäßigung für derartige Zinsen vorsieht und es keine Ausnahmebestimmung für Juden enthält.
**Erläuterung:** Auch in der Gegenwart bearbeitet zunächst der Berichterstatter den Fall und fertigt einen schriftlichen Bericht an, der aus einem Entscheidungsvorschlag und einer Begründung besteht. Der erste Satz des damaligen Berichts ist unsachlich und diskriminierend: „Der Pfl. ist Jude.“ Denn die Religion oder Rasse des Steuerpflichtigen spielt heute wie damals für die Anwendung des § 34 EStG „eigentlich“ keine Rolle.
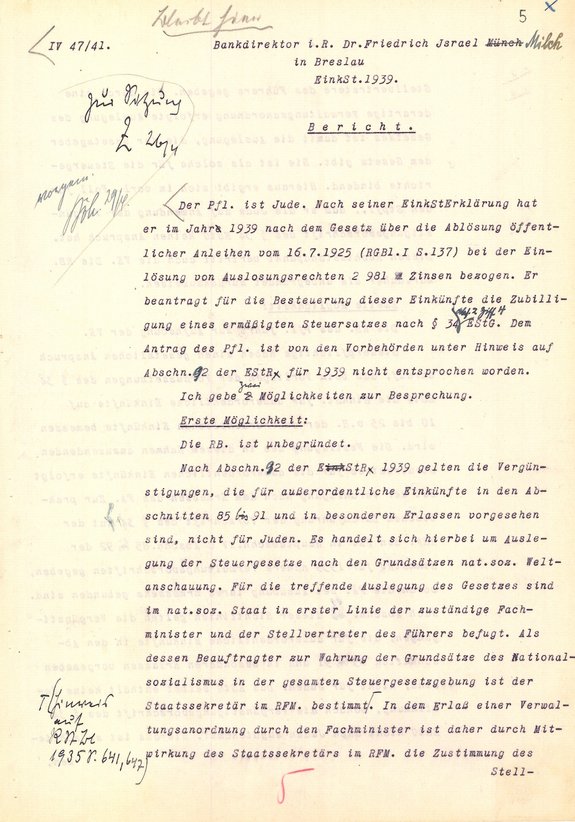
Copyright: Bundesarchiv
Der RFH will Dr. Friedrich Milch Recht geben
Mit dem folgenden Dokument hat der Senatspräsident (Vorsitzender Richter) Dr. Kurt Zülow den Reichsminister der Finanzen Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk einbezogen und diesen um Stellungnahme zu dem Bericht des Reichsrichters Robert Fleischmann gebeten. Senatspräsident Dr. Kurt Zülow führt weiter aus, dass der Senat beabsichtige, „der im … Bericht vorgeschlagenen zweiten Möglichkeit zuzustimmen“. Der IV. Senat des RFH sieht also die Rechtsbeschwerde von Dr. Friedrich Milch als begründet an und möchte ihm Recht geben.
**Erläuterung:** Auch nach heutigem Recht kann der BFH das Bundesministerium der Finanzen auffordern, dem Revisionsverfahren beizutreten und eine Stellungnahme zu der streitigen Rechtsfrage abzugeben. Dennoch ist die Einschaltung des Reichsfinanzministeriums im Fall Milch kein Ausdruck rechtsstaatlicher Normalität. Denn während die Verfahrensbeteiligung des Reichsfinanzministers in der Zeit der Weimarer Republik nur selten vorkam, nutzte das Ministerium in der NS-Zeit das Mittel des Verfahrensbeitritts und der Stellungnahme sehr häufig, um unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidungen des RFH auszuüben. Im Fall Milch wurde der Kläger zudem über die „Anfrage“ beim Ministerium nicht in Kenntnis gesetzt. Auch später wurde ihm keine Gelegenheit gegeben, sich zur Stellungnahme des Ministeriums zu äußern. Damit wurde der heute im Grundgesetz verankerte Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Grundgesetz) verletzt.
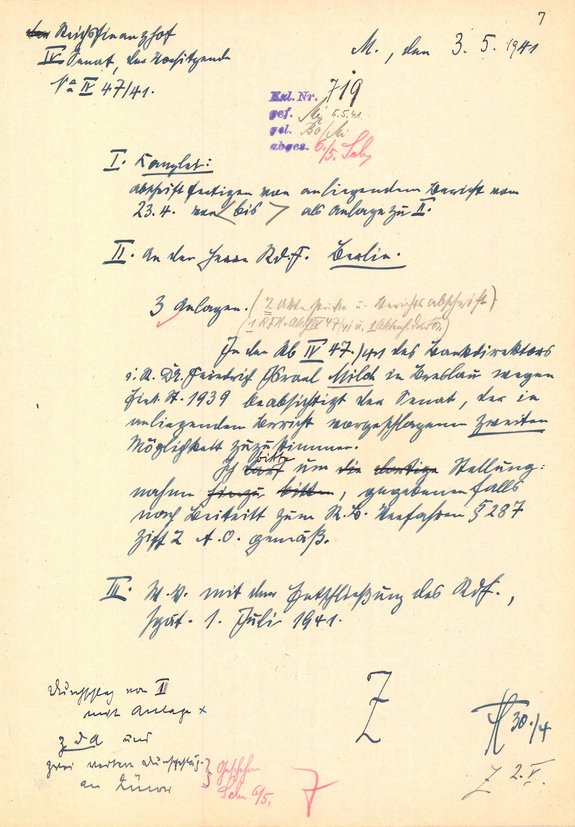
Copyright: Bundesarchiv
NS-Staatssekretär Fritz Reinhardt schaltet sich ein
Das folgende Dokument zeigt die erste Seite des zweiseitigen Antwortschreibens des Reichsministers der Finanzen vom 30. Juni 1941. Unterzeichnet ist das Schreiben von Staatssekretär Fritz Reinhardt. Während der NS-Zeit war Reinhardt die einflussreichste Person auf dem Gebiet des Steuerrechts. Fritz Reinhardt erklärt, dass er sich „damit nicht einverstanden erklären“ könne, dass der RFH der „zweiten Möglichkeit“ zustimmen, also dem Kläger Recht geben möchte. Er bittet darum, die Rechtsbeschwerde von Dr. Friedrich Milch zurückzuweisen. Der RFH dürfe dies aber nicht so begründen, wie er es selbst als „erste Möglichkeit“ erwogen habe. Vielmehr soll die Entscheidung mit einer ganz neuen Begründung, die Staatssekretär Fritz Reinhardt im dokumentierten Schreiben gleich selbst mitliefert, versehen werden. Danach „würde es der gesunden deutschen Volksanschauung widersprechen, wenn einem Juden der ermäßigte Steuersatz zugebilligt würde“. Abschließend bittet er, die Entscheidung des RFH in die amtliche Entscheidungssammlung aufzunehmen.
**Erläuterung:** Die „Bitten“ des Staatssekretärs Fritz Reinhardt waren tatsächlich Befehle und wurden von den Angehörigen des RFH auch so aufgefasst, wie das Schreiben des Reichsrichters Dr. Karl Schefold weiter unten zeigt. Die richterliche Unabhängigkeit der Richter des RFH, die heute in Art. 97 des Grundgesetzes verankert ist und einen Grundpfeiler unseres Rechtsstaats darstellt, war 1941 offenkundig beseitigt.
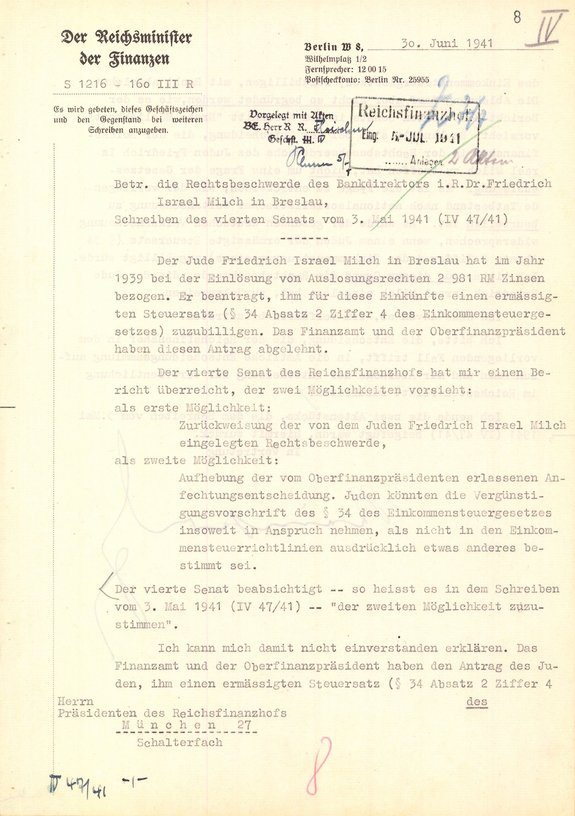
Copyright: Bundesarchiv
Das Urteil des RFH
Die Abbildung zeigt die Urschrift des Urteils des RFH vom 20. November 1941, mit dem der IV. Senat die Rechtsbeschwerde von Dr. Friedrich Milch zurückweist. In der Begründung seiner Entscheidung folgt der RFH wörtlich den schriftlichen „Vorgaben“ von Staatssekretär Fritz Reinhardt vom 30. Juni 1941 (vorherige Abbildung). Zusätzlich bildet der RFH einen amtlichen Leitsatz, mit dem das Urteil später veröffentlicht wird. Er lautet kurz und bündig: Der § 34 des Einkommensteuergesetzes ist auf Juden nicht anwendbar.
**Erläuterung:** Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes fordert, dass niemand wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seines Glaubens, seiner religiösen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Mit seinem Urteil hat der RFH Dr. Friedrich Milch, aber auch alle anderen jüdischen Steuerpflichtigen, eklatant benachteiligt, indem er ihnen den ermäßigten Steuersatz verweigerte, nur weil sie Juden waren. Dass es sich um ein Unrechtsurteil handelte, muss auch den damaligen Richtern klar gewesen sein. Denn sie wollten ursprünglich § 34 EStG entsprechend der geltenden Gesetzeslage anwenden. Welche Konsequenzen es für sie gehabt hätte, wenn sie der „Bitte“ des Staatssekretärs Fritz Reinhardt nicht gefolgt wären, können nur Historikern beurteilen.

Copyright: Bundesarchiv
Der Reichsrichter Dr. Karl Schefold beklagt den Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit
Einen Tag nachdem der IV. Senat des RFH sein Urteil im Fall Milch gefällt hatte, wandete sich der Reichsrichter Dr. Karl Schefold mit dem folgenden Dokument an den Senatspräsidenten Dr. Kurt Zülow. Er schreibt: „Dass diese Bitten“ – des Staatssekretärs Fritz Reinhardt, die Rechtsbeschwerde von Dr. Friedrich Milch mit bestimmter Begründung zurückzuweisen –, „als Weisungen gemeint sind, dürfte einem Zweifel nicht unterliegen. Sie sind so auch überwiegend in der gestrigen Sitzung des Senats aufgefasst worden und haben sich auf die geänderte Einstellung des Senats zur Sache entsprechend ausgewirkt“. Der Reichsrichter Dr. Karl Schefold beklagt den darin liegenden Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit und bittet darum, den Reichsminister der Finanzen Graf Schwerin von Krosigk einzuschalten.
**Erläuterung:** Das Schreiben des Reichsrichters Dr. Karl Schefold ist eines der aufschlussreichsten Dokumente der Verfahrensakte. Es zeigt eindringlich, dass jedenfalls in den 1940er Jahren auf dem Gebiet des Steuerrechts allein das nationalsozialistisch geführte Finanzministerium das Sagen hatte, die Mitglieder des RFH die Machtverhältnisse kannten und sie allenfalls noch darum besorgt waren, den äußeren Schein des RFH als unabhängiges Gericht zu wahren.
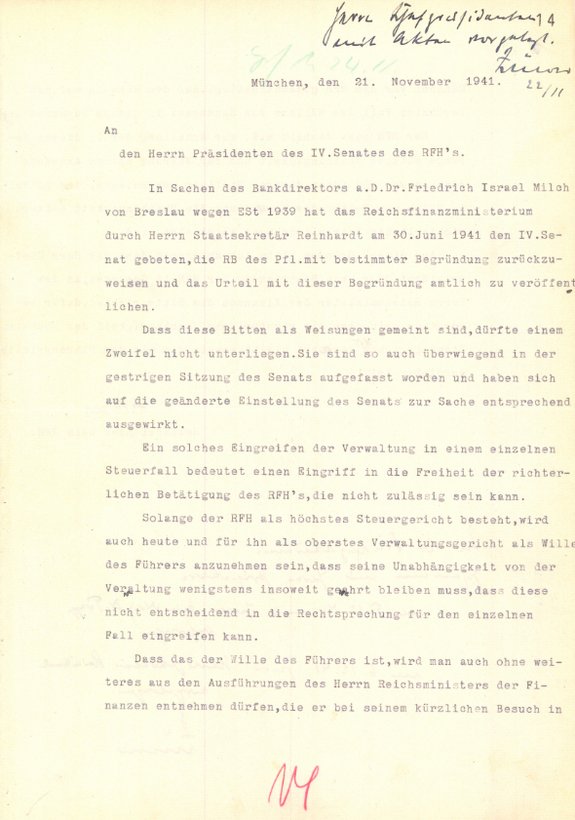
Copyright: Bundesarchiv
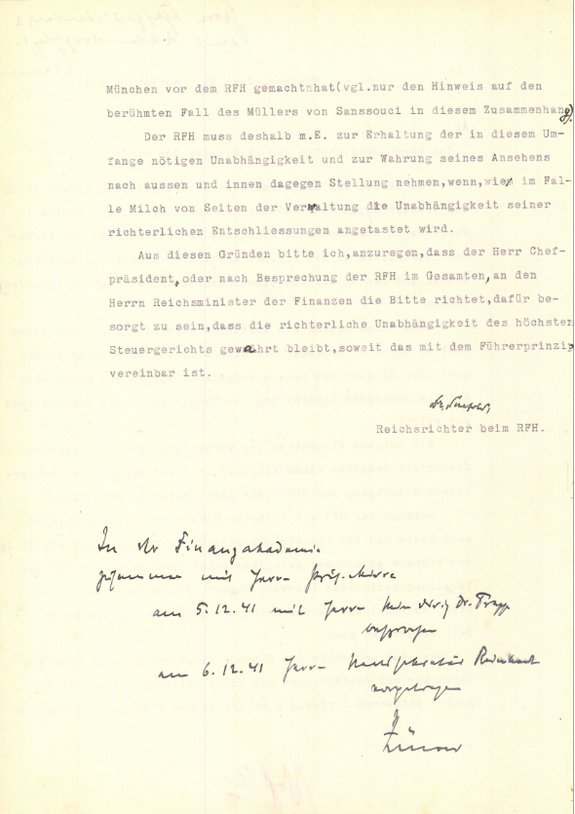
Copyright: Bundesarchiv
Unbekannt verzogen – Die Zustellung des Urteils an Dr. Friedrich Milch
Die folgende Abbildung zeigt das letzte Blatt der Akte Milch. Die Geschäftsstelle des IV. Senats hatte Dr. Friedrich Milch eine Abschrift des Urteils per Post übersandt. Die Sendung kam umgehend mit dem Vermerk „Empfänger unbekannt verzogen“ zurück. Das Finanzamt Breslau-Süd bewirkte daher auf Bitten des RFH eine öffentliche Zustellung und nahm den verschlossenen Brief zu den Steuerakten.
**Erläuterung:** Die öffentliche Zustellung, die es auch heute noch gibt, führt in der Regel nicht dazu, dass der Empfänger den Brief des Gerichts tatsächlich erhält. Es ist daher naheliegend, dass Dr. Friedrich Milch nie erfahren hat, wie der RFH über seine Rechtsbeschwerde entschieden hatte. Um das „unbekannt verzogen“ einordnen zu können, muss auf das Datum des Urteils geachtet werden. Es erging Ende November 1941. Am 25. November 1941 verließ der erste Deportationszug den Breslauer Bahnhof, mit dem etwa 1000 Juden in den Osten deportiert wurden, wo sie sofort ermordet wurden. Wenige Wochen später, am 20. Januar 1942, trafen sich Spitzenfunktionäre des NS-Staats zur berüchtigten Wannseekonferenz in Berlin, um die „Endlösung“ der Judenfrage zu organisieren.

Copyright: Bundesarchiv
Dr. Friedrich Milch emigriert
Dr. Friedrich Milch befand sich nicht in einem der Deportationszüge. Der 71-Jährige, der aus „Verwurzelung in Breslau und im Deutschtum“ so lange ausgeharrt hatte, konnte zusammen mit seiner Frau Deutschland im Oktober 1941 verlassen. Er emigrierte über Kuba in die USA aus und lebte dort zunächst völlig mittellos in Chicago. Die Bundesrepublik Deutschland gewährte ihm später eine Entschädigung. 1966 starb er im Alter von 96 Jahren in einer Stadt am Lake Michigan.
Richterpersönlichkeiten 1933–1945
1933 war der Chefpräsident des Reichsfinanzhofs Prof. Dr. Herbert Dorn. Er musste sein Amt mit Wirkung von Ende März 1934 verlassen. Dorns Nachfolger, Richard Kloß war seit 1918 am RFH tätig. Seine Präsidentschaft endete bereits im Dezember 1934. 1935 wurde Ludwig Mirre zum Präsidenten des RFH ernannt und blieb es bis zu seiner Enthebung aus dem Amt 1945. Seit 1935 nahm die Anzahl der Richter, die vorrangig gemäß nationalsozialistischer Weltanschauung entschieden, stetig zu.